Letzte Aktualisierung am: 9. September 2025
Geschätzte Lesezeit: 5 Minuten
Das Recht an der eigenen Stimme ist eine Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und schützt die individuelle Selbstbestimmung. Bis vor ein paar Jahren bezog sich dieser Schutz vor allem auf die unerlaubte kommerzielle Nutzung oder auf heimliche Aufnahmen, die die Privatsphäre verletzen. Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz konfrontieren diese Rechtslage jedoch mit völlig neuen Herausforderungen. Wie sieht die deutsche Rechtsgrundlage also genau aus, wenn es um das Recht an der eigenen Stimme geht?
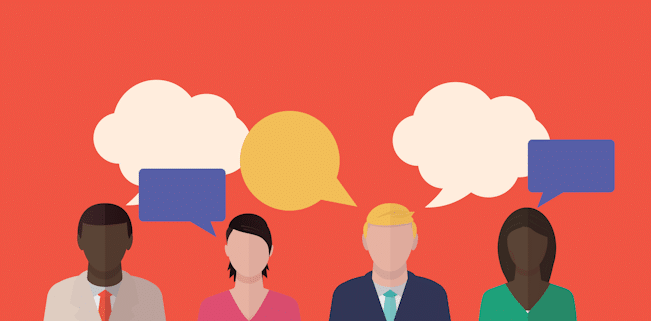
Inhalt
H2 FAQ: HKW
Nein, ein spezifisches Gesetz gibt es nicht. Der Schutz leitet sich aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht ab, das im Grundgesetz verankert ist. Auch das Recht am eigenen Bild leitet sich daraus ab.
Es schützt zwei wesentliche Bereiche: zum einen die Privatsphäre, zum anderen den wirtschaftlichen Wert der Stimme. Eine Erklärung beider Punkte finden Sie hier.
Auf sozialen Medien können Sie die rechtswidrigen Inhalte zum Beispiel direkt an die Plattform melden, damit diese sie entfernt. Mehr dazu in diesem Abschnitt.
Die Rechtsgrundlage erklärt

Ein Gesetz, das spezifisch die Stimme einer Person schützt, gibt es in Deutschland bisher nicht. Vielmehr leitet dieser Schutz sich aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht ab.
Was ist das Persönlichkeitsrecht? Das allgemeine Persönlichkeitsrecht setzt sich aus Art. 2 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes zusammen. Es gewährleistet den Schutz der individuellen Würde und die freie Entfaltung der Persönlichkeit jedes Menschen.
Es erstreckt sich auf die Aspekte, die eine Person kennzeichnen. Dazu gehören beispielsweise der Name, die Stimme, das äußere Erscheinungsbild und sogar die persönliche Ehre und die Privatsphäre.
Diverse Rechtsprechungen konkretisieren und festigen das Recht an der eigenen Stimme. Dabei schützt es in zweifacher Hinsicht:
- Der Schutz der Privatsphäre: Dieser verhindert, dass Stimmaufnahmen ohne Erlaubnis genutzt werden, um eine Person bloßzustellen oder in ihre Privatsphäre einzugreifen.
- Der wirtschaftliche Schutz: Dieser Punkt bezieht sich auf die Stimme als wirtschaftliches Gut. Ein solcher Schutz wird insbesondere dann relevant, wenn die Stimme einer Person eine derart hohe Bekanntheit aufweist, dass ihr ein eigener kommerzieller Wert zukommt.

Inwiefern das Recht an der eigenen Stimme ein anerkannter und wichtiger Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist, veranschaulicht das Gerichtsurteil des OLG Hamburg (Urteil vom 08.05.1989 – 3 W 45/89).
In diesem Fall ging es um die Nachahmung der Stimme des verstorbenen Komikers Heinz Erhardt für eine Werbung. Das Gericht entschied, dass die unverkennbare Nachahmung einer Stimme zur Täuschung des Publikums die Persönlichkeitsrechte des Verstorbenen (postmortales Persönlichkeitsrecht) verletzt.
Wie ist die eigene Stimme datenschutzrechtlich geschützt?
Das Recht auf die eigene Stimme ist nicht nur durch das Persönlichkeitsrecht, sondern auch durch die DSGVO geschützt. Der Kern des datenschutzrechtlichen Schutzes liegt in der Einstufung der Stimme als biometrisches Datum.
Laut der offiziellen Definition in Art. 4 Nr. 14 DSGVO sind das:
„mit speziellen technischen Verfahren gewonnene personenbezogene Daten zu den physischen, physiologischen oder verhaltenstypischen Merkmalen einer natürlichen Person, die die eindeutige Identifizierung dieser Person ermöglichen oder bestätigen“
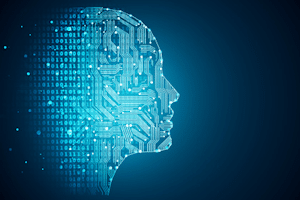
Die menschliche Stimme mit ihren einzigartigen Frequenzen und Mustern fällt genau in diese Kategorie. Wird die Stimme einer Person also ohne deren explizite Zustimmung nachgeahmt oder von der KI gefälscht, wird das Recht an der eigenen Stimme verletzt, da ein Verstoß gegen Art. 9 Abs. 1 DSGVO vorliegt.
Wer die Stimme einer Person für eine KI-Imitation nutzen will, muss sich also vorher eine freiwillige, informierte und unmissverständliche Zustimmung einholen. Ohne die Einwilligung der betroffenen Person, ziehen folgende Handlungen möglicherweise datenschutzrechtliche Konsequenzen mit sich:
- Das Aufzeichnen der Stimme, um sie für eine KI zu verwenden
- Das Speichern der Aufnahmen, um die biometrischen Merkmale zu extrahieren
- Das Trainieren eines KI-Modells mit diesen Stimmmerkmalen
- Das Generieren von gefälschten Audioinhalten ohne Zustimmung des Betroffenen
Das Recht an eigener Stimme und die KI
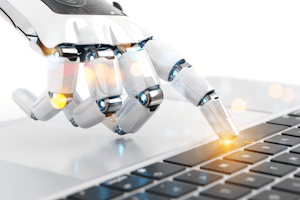
Durch künstliche Intelligenz tritt das Problem der Imitation einer Person vermehrt auf. KI-Tools, die darauf ausgerichtet sind, die Stimme einer Person nachzuahmen, können ohne die Zustimmung der Person in deren Privatsphäre eingreifen.
Sogenanntes „Voice-Cloning“ oder „Deepfakes“ werden genutzt, um Zugang zu persönlichen Daten, Konten oder Dienstleistungen zu erhalten.
Diese KI-Tools verstoßen gegen das Persönlichkeitsrecht, wenn sie die Stimme und das Bild einer Person ohne deren Einwilligung oder gegen deren Willen nutzen. Die künstliche Intelligenz kann je nach Situation in einem der folgenden böswilligen Kontexte zum Einsatz kommen:
- Missbrauch des Namens für beleidigende oder schädigende Inhalte
- Verbreitung von Falschinformationen und verleumderischen Inhalten
- Online-Mobbing und das öffentliche Bloßstellen von Personen
- Rufschädigung
Ein zukünftiges Recht an der eigenen Stimme?

Anhand dieser Tools wird es immer einfacher, das Recht an der eigenen Stimme zu verletzen. Aufgrund des schnellen Fortschritts dieser Technologien wird zunehmend darüber gesprochen, die Rechtsgrundlage anzupassen und als eigenen Gesetzestext in Deutschland zu verankern. Ein eigenständiges Recht an eigener Stimme würde die Grundlage im Falle einer Klage vereinfachen.
Bis es jedoch in Deutschland so weit ist, hat die EU 2024 das erste Regelwerk für KI eingeführt. Der „AI Act“ ist ein erster Schritt, mit dem die Gefahren der KI gegenüber natürlichen Personen bekämpft werden sollen. Er legt unter anderem die Transparenzpflicht fest. Mit KI generierte Inhalte müssen laut Verordnung stets gekennzeichnet sein. Diese Regelung soll verhindern, dass imitierte Stimmen für echt angesehen werden.
Wie Betroffene gegen einen Verstoß vorgehen können
Personen, deren Recht an der eigenen Stimme verletzt wurde, haben einige Möglichkeiten, um gegen den Verstoß vorzugehen. In einigen sozialen Medien können Nutzer beispielsweise rechtswidrige Inhalte melden. Diese Plattformen müssen diese dann umgehend entfernen.
Bei schweren Verstößen gegen das Persönlichkeitsrecht oder den Datenschutz sollten rechtliche Schritte eingeleitet werden. Dazu gehören beispielsweise Abmahnungen oder Strafanzeigen.
Das Recht an der eigenen Stimme – kurz und kompakt
Das Recht an der eigenen Stimme ist in Deutschland als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts fest verankert, das sowohl die Privatsphäre als auch den kommerziellen Wert schützt. Zusätzlich stuft die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) die Stimme als besonders schützenswertes biometrisches Datum ein. Mithilfe des neuen EU-AI-Acts soll dieser Schutz nun weiter vertieft werden, indem er eine klare Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte wie Stimmimitationen vorschreibt, um Täuschungen wirksam zu verhindern.